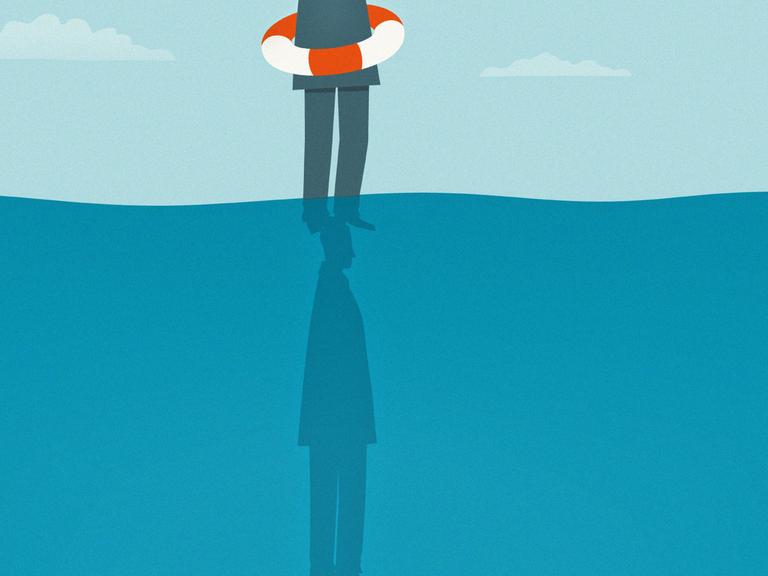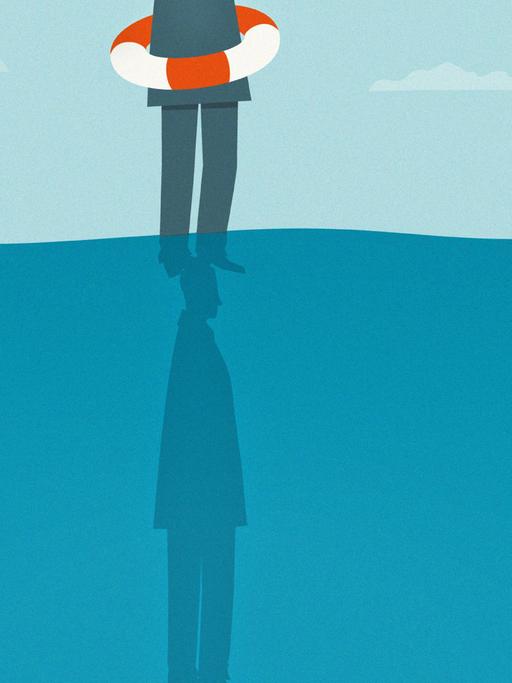"Ich will empowernde Perspektiven finden"

Simone Ayivi im Gespräch mit Sigrid Brinkmann · 29.03.2018
Simone Dede Ayivi lebt in Berlin, schreibt Texte und macht Theater. In ihrer aktuellen Performance First Black Woman in Space feiert sie schwarze Weiblichkeiten auf der Bühne. Die Diskussion um Diskriminierung und Opferrollen werde noch lange anhalten, sagt sie.
Die durch den hashtag #MeToo ausgelöste Debatte um sexuelle Belästigung und Herabwürdigungen, hat Menschen Auftrieb gegeben, über eigene Erfahrungen zu sprechen, ihre Verletzlichkeit sichtbar zu machen. Das Thema ist im Kunstbetrieb nicht minder virulent als in vielen anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Aber inzwischen wird auch Überdruss an der Debatte und an den Forderungen laut, sich immerfort politisch korrekt auszudrücken. Manche meinen gar, es sei inzwischen zu einer Mode geworden ist, sich als Opfer zu inszenieren, um spezifische Interessen gezielt durchzusetzen. Wie kann man verhindern kann, dass sich der Graben zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten vertieft?
"Political Correctness" durch "Respekt" ersetzen
Die afrodeutsche Berliner Performancekünstlerin und Theaterregisseurin Simone Dede Ayivi, die in ihren Arbeiten Stereotype über Minderheiten vorführt, zerlegt und in einen neuen Kontext setzt, meint:
Political Correctness sei ein Begriff, "der nicht von den Menschen selbst benutzt wird, die versuchen, für ihre Rechte einzustehen oder etwas einzufordern – Teilhabe an dieser Gesellschaft -, sondern als Kampfbegriff benutzt wird, um zu sagen: Wir können doch nicht immer politisch korrekt sein."
Wichtig bei allem sei: Es gehe um Respekt – "political correctness" müsse eigentlich durch diesen Begriff ersetzt werden, betonte Ayivi. Und leider bewegten sich die Dinge nicht schnell genug, sodass man weiter über Benachteiligung und Diskriminierung sprechen müsse. Das Gefühl, aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder sexueller Orientierung ausgegrenzt oder angegriffen zu werden, sei leider immer noch berechtigt – "weil es de facto immer wieder Angriffe gibt. Rassistische Beschimpfungen und Übergriffe sind leider gerade sehr stark an der Tagesordnung".
Sie persönlich halte es jedoch für das Wichtigste, nicht aus einer Opfer-Position heraus zu sprechen, sondern "empowernde, selbstermächtigende Perspektiven zu finden". Ihr Anliegen als Künstlerin sei es, "eine Gegenperspektive zu schaffen" und zu verdeutlichen: Die Communities "seien nicht immer dazu da, um darüber zu sprechen, wie schlecht es ihnen geht oder von was sie wieder Opfer geworden sind oder um andere anzugreifen. Sondern um einfach Geschichten aus ihrem Alltag und ihrer Erfahrungswelt zu erzählen."
Kann man dies tun, ohne in die didaktische Falle zu tappen? Es sei schwierig, dass immer zu vermeiden, sagt Simone Ayivi. Jeder Zuschauer bringe ja andere Voraussetzungen mit. Man könne der Didaktik-Falle erst dann entkommen, wenn es im Publikum ein breiteres Wissen gebe.
Die Debatte wird noch viele ermüden
Ayivi ist davon überzeugt, dass die Debatten um Diskriminierung und Opferrollen noch lange andauern werden. "Und wir werden noch viel ermüdeter davon sein, als wir es jetzt schon sind. Ich habe auch keine Lust, weiterhin allen zu erklären, wie Rassismus funktioniert oder was Sexismus ist."
(mkn)