Verdis rehabilitiertes Meisterwerk
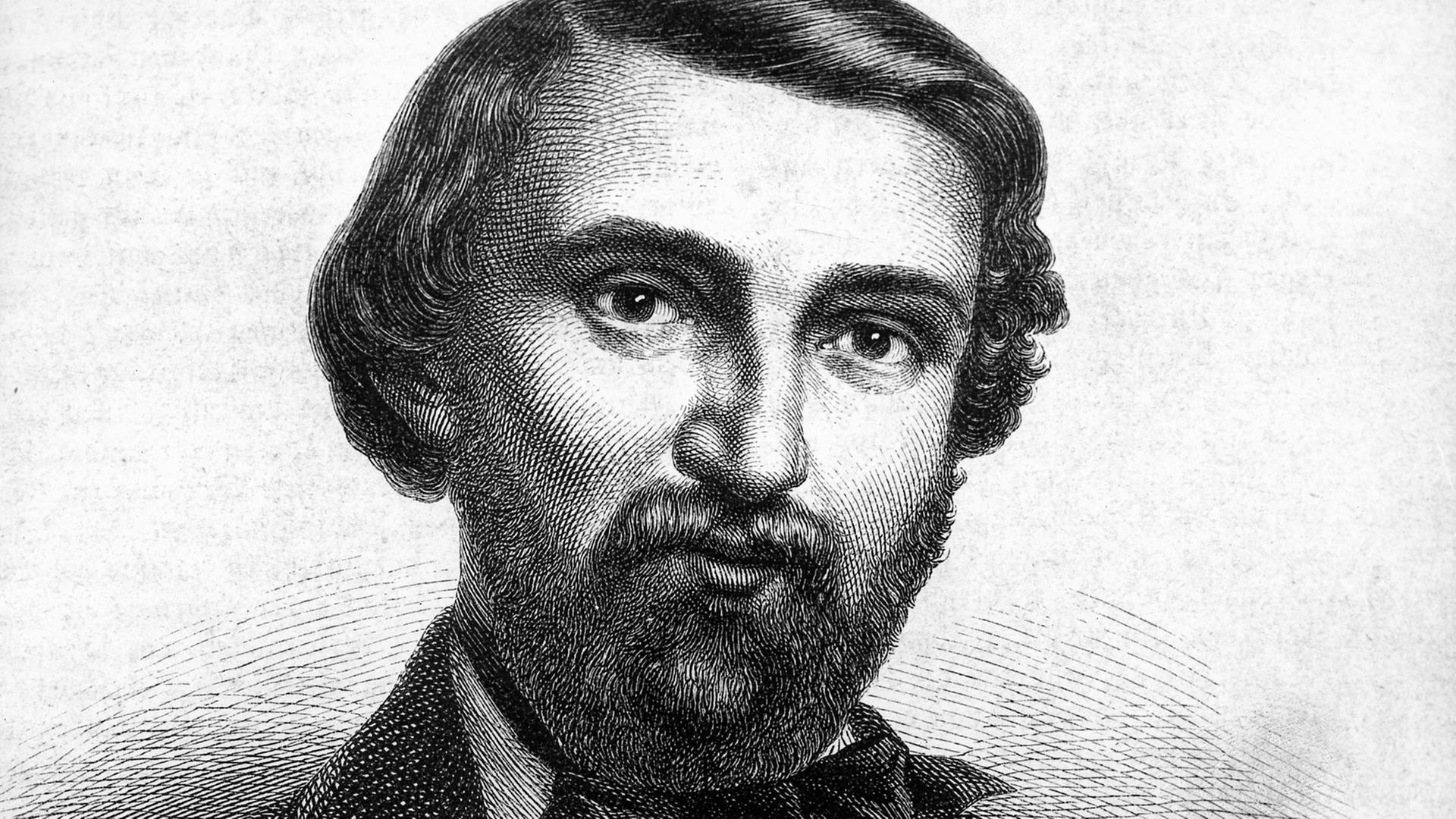
Von Dieter David Scholz · 22.01.2016
Die Oper "Stiffelio" über die Frau eines protestantischen Sektenpfarrers, die Ehebruch begangen hat, wurde zu Verdis Lebzeiten kaum und nur stark zensiert gezeigt. Die Aufführung im Teatro La Fenice in Venedig beweist, wie kompromisslos Verdis Figuren gezeichnet sind.
Das dreiaktige dramma lirico "Stiffelio", das 1850 in Triest uraufgeführt wurde, ist eine der seltsamsten wie am seltensten aufgeführten Opern Giuseppe Verdis. Schon das Sujet ist unpopulär. Immerhin geht es um die Frau eines protestantischen Sektenpfarrers, die Ehebruch begangen hat und am Ende durch göttliche Gnade Verzeihung erlangt, aus den Priesterhänden ihres betrogenen Mannes. Eine pikante Situation, zumal, wenn man bedenkt, dass es verboten war, zu Verdis Zeit Gottesdienste auf der Bühne zu zeigen.
Das Stück ist denn auch aufgrund der Eingriffe der Zensur zu Verdis Lebzeiten in den wenigen Aufführungen, die es erlebte, nur arg verstümmelt auf die Bühne gekommen. Schließlich wurde es vergessen. Man nahm an, es sei verloren. Erst 1968 wurde eine Partiturabschrift in Neapel und Wien gefunden und erst 2003 konnte es anhand aufgefundener, bisher unbekannter Skizzen und komplett rekonstruiert werden. Ein Stück, das aufgrund seines religiösen Sujets beispiellos ist und kein Vorbild im romantischen melodramma besitzt.
Es gibt zwar in Verdis Werken viele rituelle Szenen, aber in keiner Oper hat er so unverhüllt einen liturgischen Vorgang auf die Bühne gebracht, in der finalen Gottesdienstszene, wo der betrogene Ehemann mit sich ringt, um als Pastor göttliche Vergebung für seine Frau zu verkündigen. Verdi mutet seinem Publikum mit diesem von der Norm abweichenden, Stoff Ungewohntes zu. Auch heute kein leichtes Unterfangen für einen Regisseur, das Stück auf die Bühne zu bringen.
Grausame, religiöse Kastengemeinschaft
Johannes Weigand, ehemaliger Oberspielleiter der Oper an den Wuppertaler Bühnen, inzwischen amtierender Generalintendant des Anhaltischen Theaters Dessau, zeigt "Stiffelio" in einer sterilen, kalten, unkonkreten Welt hinter Gittern vor Stahlrasterwänden. Es gibt eine Art Wachturm, der im letzten Akt zur Predigtkanzel wird. Die Bühne hat den Charme von Berlin Alexanderplatz zu DDR-Zeiten. In dieser unwirtlichen Szenerie prangert Weigand mit sängerfreundlicher, sehr genau auf die Musik achtender Personenführung eine grausame, unmenschliche, religiöse Kastengemeinschaft an, in der es nur um Schande, Ehre, Pflicht und strenge Gottesfurcht geht, hinter der sich aber Heuchelei und menschliche Abgründe verbergen, vor allem in Gestalt Stifflios, eines Antihelden mit heftigen Widerprüchen und psychischen Einbrüchen.
Keine kulinarische Inszenierung, aber eine in sich logische, überzeugende, die das Stück beglaubigt und dafür plädiert, diese frühe, selten gespielte Oper Verdis auf die Bühne zu bringen, schon weil sie zeigt, wie Verdi schon vor seiner Trias "Rigoletto", "Trovatore" und "Traviata" in der er einen buckligen Narren, eine rachsüchtige Zigeunerin und eine schwindsüchtige Dirne auf die Bühne bringt, was zu seiner Zeit ungeheuerlich war, mit den Konventionen der Oper bricht und das Opernpublikum in seinen Erwartungen vor den Kopf stößt. Wie er in einem Brief schrieb, wollte er gewagte Stoffe, extreme Stoffe auf die Bühne bringen.
Analytisch scharfes Dirigat
Schon im "Stiffelio" bewies Verdi, wie man in Venedigs Aufführung lernt, was für ein kompromissloser Menschendarsteller er war. Auch musikalisch beglaubigt die aufrüttelnde Aufführung das Werk. Der junge Mailänder Dirigent Daniele Rustoni treibt das Orchester des Teatro La Fenice erbarmungslos an. Mit straffem, analytisch scharfem Dirigat macht Rustoni deutlich, welchen unglaublichen musikalischen Röntgenblick Verdi schon in diesem frühen Stück entwickelt hat. Die Musik des "Stiffelio" ist erschütternd anders als das konventionelle melodramma seiner Zeit. Verdi geht in dieser Oper entschlossen auf ein neuartiges, wahrhaftig menschliches Musikdrama zu. Zwar bedient er die Konventionen der Oper, es gibt noch konventionelle Arien, Chöre, Ensembles, aber auch eben ganz neuartige Töne und eine Musikdramaturgie des offenen Schlusses.
Auch sängerisch ist die Aufführung auf hohem Niveau. Ein halbes Dutzend erstklassiger Sänger hört man in Venedig. Stefano Secco verkörpert die gewaltige Tenorpartie des Stiffelio belcantisch-heldenhaft. Der griechische Bariton Dimitri Platanias singt einen angsteinflößend-ungeheuren, vom Ehrbegriff angenagten Vater der Ehebrecherin Lina. Diese wird von der beleibten Italoamerikanerin Juliana Di Giacomo gesungen, einer beleibten, hochdramatisch wagnerhaften "Singmaschine", die statt auf Phonstärke mehr auf Gesangskultur hätte setzen sollen. Eine außerordentliche Verdistimme kann man ihr allerdings nicht absprechen. Insgesamt ein großer Verdiabend, der ein vergessenes frühes Meisterwerk Verdis rehabilitiert.






