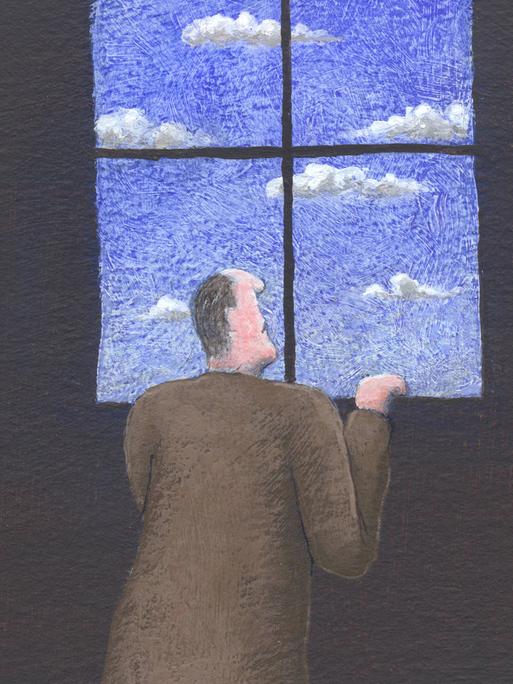"Resiliente Sportler" sind das Ziel
06:56 Minuten

Von Thomas Wheeler · 10.11.2019
Vor zehn Jahren nahm sich der Fußballtorwart Robert Enke das Leben. Was hat sich seit damals im Umgang mit der Krankheit Depression getan? Zwei Psychologinnen sprechen über ihre Arbeit am Olympiastützpunkt Berlin.
Athletinnen und Athleten aus über 30 olympischen Sportarten trainieren am Olympiastützpunkt Berlin. Alle haben sich für eine Spitzensport-Karriere entschieden und wollen erfolgreich sein. Bei Deutschen Meisterschaften genauso wie bei internationalen Titelkämpfen.
Doch nicht immer läuft alles glatt: Verletzungen, Probleme in der Schule oder Ausbildung, private Schwierigkeiten. All das kann natürlich auch einen Sportler aus dem Takt bringen. Wenn dann Hilfe nötig ist, gibt es zwei Psychologinnen am OSP. Die eine heißt Brit Wilsdorf, sie ist erst seit einem guten Jahr dabei:
"Hab' sowohl eine sportpsychologische Ausbildung, aber auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Mache quasi auch ein bisschen klinische Arbeit am OSP. Das heißt, Diagnostik oder halt auch mal Krisenintervention am OSP."
"Hab' sowohl eine sportpsychologische Ausbildung, aber auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Mache quasi auch ein bisschen klinische Arbeit am OSP. Das heißt, Diagnostik oder halt auch mal Krisenintervention am OSP."
Niedrigschwellige Hilfsangebote
An ihrer Seite arbeitet Monika Liesenfeld. Sie ist bereits seit 2005 am Olympiastützpunkt tätig. Dadurch ist sie auch einer Vielzahl von Sportlerinnen und Sportlern, sowie Trainerinnen und Trainern bekannt:
"Man braucht Psychotherapeuten, die sich im Sport auskennen, und auch Psychiater. Wir arbeiten sportpsychologisch und kriegen dann mit, wenn's abrutscht ins Klinische, und dann braucht man die Netzwerke, die Ansprechpartner, und hier ist es natürlich wichtig, dass die Sportpsychologen gut ausgebildet sind, und ich finde, da hat sich in den letzten zehn Jahren wirklich einiges getan."
Die 2010 gegründete Robert-Enke-Stiftung hat zusammen mit diversen Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen ein bundesweites Netzwerk geschaffen, in dem 70 Sportpsychiater sowie Sportpsychologen und Psychotherapeuten Ansprechpartner für Betroffene und deren Angehörige sind. Der Kreis erweitert sich stetig, betont Brit Wilsdorf in der Hauptstadt:
"Am Anfang waren es mehr die Universitätskliniken. Mittlerweile sind's auch außeruniversitäre Kliniken und auch eine relativ lange Liste an Experten."
Das Hilfsangebot ist bewusst niedrigschwellig angelegt. Über eine Hotline können sich Athleten erst einmal informieren und gegebenenfalls beraten lassen. Aber auch, wenn es im letzten Jahrzehnt gelungen ist, psychische Krankheiten bei Sportlern zu entstigmatisieren, fällt es vielen von ihnen immer noch schwer, sich zu öffnen und einem Experten oder einer Expertin anzuvertrauen.
"Man braucht Psychotherapeuten, die sich im Sport auskennen, und auch Psychiater. Wir arbeiten sportpsychologisch und kriegen dann mit, wenn's abrutscht ins Klinische, und dann braucht man die Netzwerke, die Ansprechpartner, und hier ist es natürlich wichtig, dass die Sportpsychologen gut ausgebildet sind, und ich finde, da hat sich in den letzten zehn Jahren wirklich einiges getan."
Die 2010 gegründete Robert-Enke-Stiftung hat zusammen mit diversen Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen ein bundesweites Netzwerk geschaffen, in dem 70 Sportpsychiater sowie Sportpsychologen und Psychotherapeuten Ansprechpartner für Betroffene und deren Angehörige sind. Der Kreis erweitert sich stetig, betont Brit Wilsdorf in der Hauptstadt:
"Am Anfang waren es mehr die Universitätskliniken. Mittlerweile sind's auch außeruniversitäre Kliniken und auch eine relativ lange Liste an Experten."
Das Hilfsangebot ist bewusst niedrigschwellig angelegt. Über eine Hotline können sich Athleten erst einmal informieren und gegebenenfalls beraten lassen. Aber auch, wenn es im letzten Jahrzehnt gelungen ist, psychische Krankheiten bei Sportlern zu entstigmatisieren, fällt es vielen von ihnen immer noch schwer, sich zu öffnen und einem Experten oder einer Expertin anzuvertrauen.
Hilfe anzunehmen ist nicht einfach
"Wir haben festgestellt zu Beginn unserer Arbeit 2015, dass es einfach sehr lange braucht, bis die Sportler dann tatsächlich auch psychotherapeutische Hilfe oder psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, dass diese Sprechstunden zwar angeboten, aber gar nicht so viel frequentiert werden, wie sie werden könnten."
Inzwischen werden diese stärker angenommen. Es bleibt jedoch eine Hürde, sich zu diesem Schritt durchzuringen, sagt Monika Liesenfeld:
"Die Offenheit dafür ist schon größer geworden, und trotzdem ist es ja eine psychische Erkrankung und immer noch nicht das, was man gerne erzählt, oder man sich öffnen möchte."
Inzwischen werden diese stärker angenommen. Es bleibt jedoch eine Hürde, sich zu diesem Schritt durchzuringen, sagt Monika Liesenfeld:
"Die Offenheit dafür ist schon größer geworden, und trotzdem ist es ja eine psychische Erkrankung und immer noch nicht das, was man gerne erzählt, oder man sich öffnen möchte."
Aufklärungsarbeit sei weiterhin das A und O, erklärt Brit Wilsdorf:
"Auch Diagnosekriterien durchzusprechen. Was bedeutet eigentlich eine Depression? Es bedeutet jetzt nicht, mal einen schlechten Nachmittag zu haben, sondern das sind schon zwei Wochen am Stück, wo die Stimmung wirklich sehr niedergeschlagen ist."
In besonders schlimmen Phasen konnte Robert Enke, der frühere Bundesliga- und Nationalmannschaftstorhüter, nicht aus dem Haus gehen, dunkelte alles ab und wollte nicht mehr aufstehen. Er sagte dann oft zu seiner Frau: "Teresa, wenn du eine Minute in meinem Kopf wärst, würdest du sehen, wie furchtbar und schrecklich das ist."
Wichtig sei bei der Präventionsarbeit nicht nur, die Athleten darüber zu informieren, was eine Depression ist, sondern auch deren Umfeld, meint Psychologin Monika Liesenfeld:
"Das ganze System muss aufgeklärt werden, und wenn das passiert, merkt man auch, dass das alle Beteiligten entlastet, nicht freispricht von irgendwelchen Aufgaben, aber es entlastet einfach erst mal."
"Auch Diagnosekriterien durchzusprechen. Was bedeutet eigentlich eine Depression? Es bedeutet jetzt nicht, mal einen schlechten Nachmittag zu haben, sondern das sind schon zwei Wochen am Stück, wo die Stimmung wirklich sehr niedergeschlagen ist."
In besonders schlimmen Phasen konnte Robert Enke, der frühere Bundesliga- und Nationalmannschaftstorhüter, nicht aus dem Haus gehen, dunkelte alles ab und wollte nicht mehr aufstehen. Er sagte dann oft zu seiner Frau: "Teresa, wenn du eine Minute in meinem Kopf wärst, würdest du sehen, wie furchtbar und schrecklich das ist."
Wichtig sei bei der Präventionsarbeit nicht nur, die Athleten darüber zu informieren, was eine Depression ist, sondern auch deren Umfeld, meint Psychologin Monika Liesenfeld:
"Das ganze System muss aufgeklärt werden, und wenn das passiert, merkt man auch, dass das alle Beteiligten entlastet, nicht freispricht von irgendwelchen Aufgaben, aber es entlastet einfach erst mal."
Streben nach Erfolg und Anerkennung
Der Leistungssport befindet sich in einem Spagat. Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden, streben nach Erfolg und nach Anerkennung. Das ist jedoch nur dann möglich, wenn die Aktiven gesund sind und sich klar machen, dass es neben dem Sport auch noch eine andere Welt gibt. Auch das ist Teil der Prävention, erklärt Brit Wilsdorf:
"Wie können wir resiliente Sportler formen, die eben auch mehrdimensional ausgerichtet sind, also nicht nur auf den Sport. Auch Schule ist wichtig, ein Freundeskreis ist wichtig. Also wirklich die Sportler auch zu autonomen Sportlern zu erziehen, und da versuchen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, die Trainer auch mitzunehmen, dass sie ihren Nutzen auch darin sehen und ihre Chancen auch darin sehen. Und ich finde, da sind viele, die da auch mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen."
Um dies sicherzustellen, darf sich der Fokus schon in der Nachwuchsförderung nicht nur allein aufs Siegen konzentrieren. Auch die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Sportlern spielt in der psychologischen Arbeit eine Rolle.
"Wie können wir resiliente Sportler formen, die eben auch mehrdimensional ausgerichtet sind, also nicht nur auf den Sport. Auch Schule ist wichtig, ein Freundeskreis ist wichtig. Also wirklich die Sportler auch zu autonomen Sportlern zu erziehen, und da versuchen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, die Trainer auch mitzunehmen, dass sie ihren Nutzen auch darin sehen und ihre Chancen auch darin sehen. Und ich finde, da sind viele, die da auch mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen."
Um dies sicherzustellen, darf sich der Fokus schon in der Nachwuchsförderung nicht nur allein aufs Siegen konzentrieren. Auch die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Sportlern spielt in der psychologischen Arbeit eine Rolle.
Monika Liesenfeld: "Also die, die ich in Therapie hatte, und ich hatte in den letzten Jahren einige Sportler in Psychotherapie, da war immer das Thema: Wer bin ich außerhalb des Sports? Was macht mich aus? Welche Selbstidentität außerhalb des Sports, immer ein Thema, was zu kurz gekommen ist. Und da gerade eben zu gucken, welche Entwicklungsaufgaben hat derjenige vielleicht gut bewältigt, und wo hapert's vielleicht."
Fünf Millionen Menschen erkranken pro Jahr
Durchschnittlich fünf Millionen Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an einer Depression. Dass dabei auch Sportlerinnen und Sportler betroffen sind, ist bei einem Querschnitt der Bevölkerung nachvollziehbar. Wobei dies nicht zwangsläufig das Ende der sportlichen Laufbahn bedeuten muss, betont Brit Wilsdorf:
"Da merken wir, dass es ganz, ganz viele Sportler gibt, die in solchen Krisenphasen auch daraus gestärkt hervorgegangen sind. Dass es auch nach 'ner Depressionsbehandlung dann 'ne Leistungssportkarriere geben kann."
Am letzten Montag ist der Olympiastützpunkt Berlin von der Robert-Enke-Stiftung mit dem Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport ausgezeichnet worden. Mit dem Geld wollen die Psychologinnen am OSP ihr Angebot weiter ausbauen.
Brit Wilsdorf: "Mehr Präventionsarbeit, Workshops, mehr mit den Trainern arbeiten, mehr Angebote für die Sportler machen, aber halt auch mehr Zeit für Einzelarbeit, mehr zu den Trainingsstätten hingehen, präsenter zu sein."
"Da merken wir, dass es ganz, ganz viele Sportler gibt, die in solchen Krisenphasen auch daraus gestärkt hervorgegangen sind. Dass es auch nach 'ner Depressionsbehandlung dann 'ne Leistungssportkarriere geben kann."
Am letzten Montag ist der Olympiastützpunkt Berlin von der Robert-Enke-Stiftung mit dem Förderpreis Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport ausgezeichnet worden. Mit dem Geld wollen die Psychologinnen am OSP ihr Angebot weiter ausbauen.
Brit Wilsdorf: "Mehr Präventionsarbeit, Workshops, mehr mit den Trainern arbeiten, mehr Angebote für die Sportler machen, aber halt auch mehr Zeit für Einzelarbeit, mehr zu den Trainingsstätten hingehen, präsenter zu sein."
Monika Liesenfeld ergänzt:
"Der OSP Berlin ist der einzige in ganz Deutschland, der eine Stelle hat für Sportpsychologie. Die anderen, außer Hannover, haben angefangen mit einer halben Stelle, haben sie jetzt aufgestockt auf eine dreiviertel, alle anderen arbeiten auf Honorarbasis. Also von daher sind wir da Gott sei Dank schon ein bisschen Vorreiter, aber der Bedarf ist natürlich größer."
"Der OSP Berlin ist der einzige in ganz Deutschland, der eine Stelle hat für Sportpsychologie. Die anderen, außer Hannover, haben angefangen mit einer halben Stelle, haben sie jetzt aufgestockt auf eine dreiviertel, alle anderen arbeiten auf Honorarbasis. Also von daher sind wir da Gott sei Dank schon ein bisschen Vorreiter, aber der Bedarf ist natürlich größer."