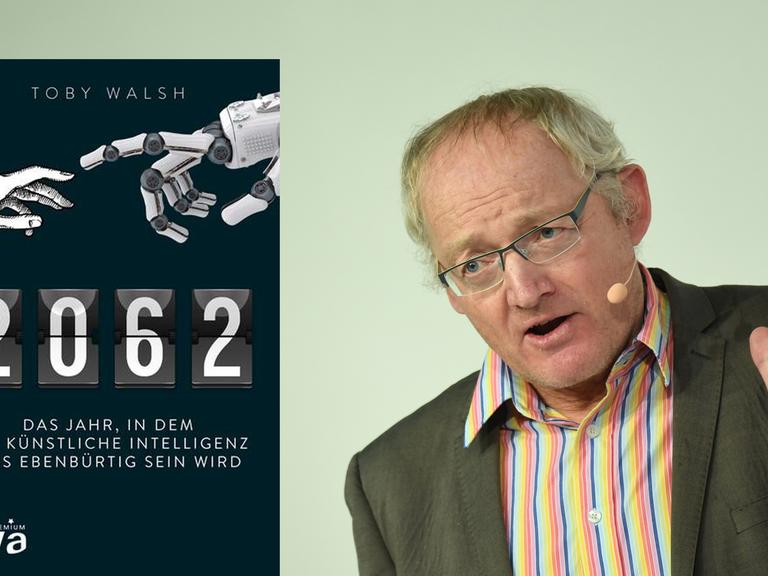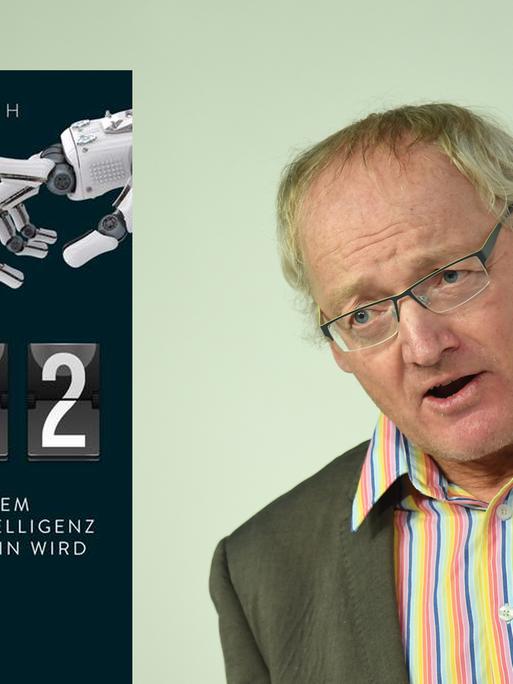Prof. Irene Bertschek leitet den Forschungsbereich "Digitale Ökonomie" am Leibnitz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, und sie ist Professorin für "Ökonomie der Digitalisierung" an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Mai 2019 wurde sie in die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) der Bundesregierung berufen. Irene Bertschek studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und der Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgien, wo sie auch promovierte. Ihre Studien-Schwerpunkten waren Ökonometrie und Industrieökonomik.
Lieber schneller als immer perfekt
29:25 Minuten

Moderation: Annette Riedel · 07.09.2019
Bei der Digitalisierung hinken Politik und Unternehmen in Deutschland den Entwicklungen hinterher, mahnt die Ökonomin Irene Bertschek. Es gebe viele Bereiche, wo es "gar keine Fortschritte" gebe. "Unterirdisch" findet Bertschek das.
Es mangele nicht mehr unbedingt an Strategien der Bundesregierung - etwa im Bereich Künstliche Intelligenz oder zur Förderung von Forschung und Entwicklung, auch nicht an Geld. Das Problem sei vielmehr die schleppende Umsetzung richtiger Ziele.
Kulturelle Aspekte für Deutschlands zögerliche Fortschritte
Dass Deutschland in den letzten Jahren weniger Innovationskraft als andere Länder - China und die USA etwa - entwickelt habe, habe auch "gewisse kulturelle Aspekte". So sei hierzulandedie Risikobereitschaft weniger ausgeprägt. "Man möchte Scheitern möglichst vermeiden." Zudem neige man zu "Perfektionismus", der manchmal die notwendige Schnelligkeit verhindere. Auch die gegebene Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten verzögere Entwicklungen.
Als eine der Hauptursachen dafür, dass Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinke, bezeichnet die Ökonomin aber die mangelhafte digitale Infrastruktur. Da sei Deutschland EU-weit und international unter den Schlusslichtern.
Unterm Strich entstehen mehr Arbeitsplätze
In Deutschland sei im Zusammenhang mit der digitalen Revolution keine Massenarbeitslosigkeit durch die Veränderungen der Arbeitswelt zu befürchten. Sie erwarte, dass "ein leicht positiver Effekt für die Beschäftigung möglich ist".
Das Interview im Wortlaut:
Deutschlandfunk Kultur: Frau Bertschek, "die Bundesregierung hat die Digitalisierung verschlafen". Dieses ziemlich verheerende Zeugnis wurde ihr im Handelsblatt im vergangenen Frühling 2018 ausgestellt, aber auch von der Expertenkommission für Forschung und Innovation im vergangenen Jahr. Ist sie denn inzwischen aufgewacht?
Irene Bertschek: Ja, ich denke, aufgewacht ist sie auf jeden Fall, schon länger sogar, aber es gibt einfach noch zu viele Bereiche, wo wenig bis gar keine Fortschritte stattfinden.
Deutschlandfunk Kultur: Sie sind ja seit Mai selbst Mitglied in der besagten Expertenkommission für Forschung und Innovation, kurz EFI genannt. Die berät die Bundesregierung. Seit diesem Gutachten 2018 hat es 2019ein neues gegeben. Tut sich denn seitdem nicht nur einiges, sondern genug und vielleicht sogar noch das Richtige?
Bertschek: Es tut sich auf jeden Fall sehr, sehr viel. Es gibt sehr viele Strategien, die die Bundesregierung entwickelt hat und weiterentwickelt. Es gibt viele Ziele, die definiert werden. Aber es fehlt zum Teil noch an der Umsetzung, damit man hier Schritte vorankommt.
Deutschlandfunk Kultur: Aber das, was man angedacht hat, was man umsetzen muss, geht schon in die Richtung dessen, was Sie "intelligente Förderung" nennen würden?
Bertschek: Ja, durchaus. Also, die Ziele, die gesetzt wurden, und auch die Maßnahmen, die vorgenommen werden, um diese Ziele zu erreichen, gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es bedarf eben jetzt der Umsetzung dieser Maßnahmen. Und zum Teil bedarf es auch noch gezielterer Maßnahmen.
Deutschlandfunk Kultur: Nun ist Geld nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Es gibt das Ziel, vorgegeben von der Bundesregierung, 3,5 Prozent der Wirtschaftskraft in Forschung und Entwicklung zu investieren. Da ist man noch nicht. Aber ist es denn als Ziel genug? Andere Länder investieren da deutlich mehr.
Bertschek: Sicher kann man diese Zahlen immer weiter höher setzen. Zunächst mal ist es wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Die Bundesregierung hat nun aber auch beschlossen - und das war auch eine Forderung der EFI-Kommission sowie auch anderer Institute, wie beispielsweise auch des ZEW - die steuerliche F+E-Förderung endlich einzuführen, also insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen dabei zu fördern, wenn sie selbst Forschung und Entwicklung tätigen, dies dann auch steuerlich zu fördern.
Gute Ideen identifizieren, bewerten, fördern
Deutschlandfunk Kultur: Ein Teil der Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, ist auch eine Agentur zur Förderung von Sprunginnovation, also für bahnbrechende Innovationen, einzurichten. Auch das war eine Forderung der Expertenkommission. Was soll und muss so eine Agentur können? Denn mindestens eine Milliarde Euro sollen über sie in den kommenden zehn Jahren investiert werden.
Bertschek: Wichtig ist, dass so eine Agentur unabhängig ist, also nicht politisch beeinflusst wird, dass sie die richtigen Köpfe zusammenbringt, um letztlich gute Ideen auch zu bewerten und dann zu fördern. Es ist ja jetzt auch eine Findungskommission eingesetzt worden, die einen Direktor für die Agentur für Sprunginnovation gefunden hat. Das ist Rafael Laguna de la Vera, also eine Person, die sowohl in der Startup-Szene sehr bekannt ist und erfahren ist und gute Erfahrungen hat mit der Entwicklung neuer Ideen. Und es wird jetzt drauf ankommen, welche Personen man noch dafür gewinnt, für die Agentur tätig zu werden, um dann gute Ideen wirklich zu bewerten, zu identifizieren und dann letztlich auch zu fördern. Da ist es wichtig, dass dann auch die entsprechenden Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.
Deutschlandfunk Kultur: Nun kann man Innovation bekanntlich nicht bestellen. Es ist so, dass in Deutschland die Innovationskraft offenbar erheblich nachgelassen hat. Deutschland war lange unter den Top-Drei bei den Anmeldungen von Patenten. Heute meldet China siebenmal mehr an. Und es gibt auch immer weniger bahnbrechende Innovationen, die aus Deutschland kommen. 1980 war das noch jedes zweite Patent. Heute ist es nur noch jedes fünfte. Also, wie gesagt, Geld alleine tut’s nicht. Was muss noch passieren?
Bertschek: Wichtig ist, dass Talente im Land gehalten werden oder nach Deutschland geholt werden, die auch dazu beitragen, neue Ideen und Innovationen zu entwickeln. Der Vergleich, den Sie gerade genannt haben mit China, hinkt natürlich immer ein bisschen, weil China allein durch seine schiere Größe in der Lage ist, mehr Patente anzumelden.
Innovationskraft in Deutschland zurückgegangen
Deutschlandfunk Kultur: Aber man hat China lange verspottet, sozusagen als Copycat, als diejenigen, die nur alles nachbauen. Und da hat sich einfach etwas verändert. Das muss man aus diesen Zahlen schon herauslesen.
Bertschek: Das ist richtig, aber die reine Quantität ist auch nicht immer gleich Qualität eines Patents. Wichtig ist ja nicht nur, dass ein Patent angemeldet wird, sondern dass ein Patent auch in anderen Patenten zitiert wird - also, dass andere Erfindungen Bezug nehmen auf dieses Patent. Insofern sollte man sich da auch immer weitere Zahlen anschauen, wenn man die Innovationskraft vergleicht.
Aber Sie haben sicherlich Recht, dass die Innovationskraft in Deutschland zum Teil zurückgegangen ist, dass es zum Teil auch schwieriger wird, neue Ideen zu entwickeln, weil einfach auch schon viel entwickelt wurde, und dass immer mehr Input, Innovationsausgaben getätigt werden müssen, um dann letztlich auch einen Output zu generieren. Da ist eben wichtig, dass die finanziellen Mittel da sind, dass die Talente da sind und dass auch der Freiraum da ist, Innovationen zu entwickeln und auszuprobieren.
Da sind wir dann auch zum Beispiel beim Thema, von dem man im Bereich der Digitalisierung oft spricht. Das sind die sogenannten Experimentierräume, dass man eben auch Räume schafft, um neue Ideen auszuprobieren in gewissem Rahmen, bevor sie dann in die Realität umgesetzt werden.
Deutschlandfunk Kultur: Sie haben den Aspekt Fachkräfte angesprochen. Da zeichnet sich ja ab, dass der Fachkräftemangel in dem Bereich nicht etwa kleiner wird, sondern wahrscheinlich eher größer. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat festgestellt, dass schon heute 40.000 Informatiker fehlen. Das sind doppelt so viele wie vor drei Jahren. Gleichzeitig ist aber im vergangenen Jahr die Zahl der Informatikstudienanfänger gesunken. Wie kann das sein?
Bertschek: Ja. Wie kann das sein? Also, dass der Bedarf steigt, das ist, glaube ich, nicht überraschend.
Informatik in Schulen früh zum Pflichtfach machen
Deutschlandfunk Kultur: Nein. Aber sehen denn diejenigen, die sich auf den Weg ins Berufsleben machen, nicht, wie groß der Bedarf ist? Warum zieht es sie nicht in diesen Bereich?
Bertschek: Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt auch viele Studienabbrecher oder Menschen, die im IT-Bereich tätig sind, die kein abgeschlossenes Studium haben. Es gibt immer noch sehr viele Quereinsteiger in diesem Feld. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in den Schulen noch zu wenig getan wird, um junge Menschen für diese Fächer – es geht ja nicht nur um Informatik, sondern auch um die MINT-Fächer insgesamt, also Maschinenbau, Naturwissenschaften – zu begeistern. Ich denke, dass man da viel früher einfach ansetzen muss, Informatik früher zum Pflichtfach machen sollte in den Schulen, damit die Menschen Vorstellungen davon bekommen, wie so ein Berufsbild am Ende aussehen kann, um sie dafür zu begeistern. Da wird noch zu wenig getan.
Deutschlandfunk Kultur: Inwieweit hat die Tatsache, dass wir da so ein bisschen hinterher hinken, auch kulturelle Aspekte? Will sagen: Risikokultur. Wir haben bei uns vielleicht weniger Risikobereitschaft als anderswo. In Zahlen sieht man das zumindest bei der geringen Summe von Wagniskapital, das in Deutschland zur Verfügung steht. Gerade mal eine Milliarde war es zumindest 2017 nur, und in den USA fast 64 Milliarden. Und es gibt auch nicht so etwas wie eine Kultur des Scheiterns, in dem Sinne von einfach mal ausprobieren und gucken, was dabei rumkommt. Haben wir auch ein bisschen ein kulturelles Problem?
Bertschek: Ja. Das ist sicherlich so, dass wir in Deutschland zum Perfektionismus neigen. Das Ingenieurswesen ist ja ein Bereich, in dem Dinge entwickelt werden, die möglichst perfekt sein sollen, bevor sie auf den Markt kommen. Das heißt, man möchte Scheitern möglichst vermeiden. Das ist in den USA oder auch in anderen Ländern sicherlich nicht so. Also, gewisse kulturelle Aspekte spielen da sicherlich eine Rolle.
Deutschlandfunk Kultur: Und vielleicht auch so was wie das, was die Bundesregierung in ihrer Strategie für die Entwicklung künstlicher Intelligenz einen "demokratischen Anspruch", im Zusammenhang mit dieser Technologie nennt? Da heißt es: "Es soll eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz angestrebt werden."
Das heißt also, man will sehr wohl bedenken, was man da tut, und hat - vielleicht berechtigterweise - vielleicht ist das auch was Positives, gewisse Hemmungen, alles zu tun, alles zu entwickeln, was möglich ist?
Bertschek: Ja, das ist sicherlich ein Unterschied beispielsweise zu den USA oder auch China, wo man ethische Aspekte der Künstlichen Intelligenz erstmal eher ausblendet und einfach schaut, was geht, was kann man entwickeln und man relativ schnell mit Lösungen auf den Markt geht, während man in Deutschland eben diese Bedenken hegt, dann auch alle ethischen Aspekte abdecken möchte, bevor man sozusagen die schnelle Lösung sucht – also eben die Tendenz zu perfekten Lösungen, nicht unbedingt zu schnellen Lösungen. Aber manchmal sind halt schnelle Lösungen einfach wichtiger. Da ist in Deutschland sicherlich ein Hemmnis.
Bedenkliche Defizite bei digitaler Infrastruktur
Deutschlandfunk Kultur: Wo sehen Sie denn jetzt die vordringlichsten weiteren Aufgaben der Politik – jenseits der Finanzierung und der finanziellen Förderung, über die wir schon gesprochen haben. Ist es in erster Linie die zur Zurverfügungstellung oder die Weichenstellung dafür, dass wir überall schnelles Internet bekommen? Das ist ja schon verrückt, wenn man OECD-Zahlen liest, dann sind wir auf Platz 28 von 32 der industriellen Länder, was schnelles Internet angeht, und auf Platz 20 von 28 EU-Mitgliedern.
Bertschek: Ja. Das ist sehr bedenklich. Das ist sicherlich nicht alles, die digitale Infrastruktur bzw. schnelles Internet. Aber man muss wissen, dass es einfach eine essentielle Voraussetzung für alle digitalen Anwendungen ist: mobile Anwendungen, Cloud-Computing, Big Data, maschinelles Lernen. Das sind die Anwendungen, die auch schnelle Internetverbindungen benötigen – oder auch Industrie 4.0, autonomes Fahren.
Das heißt, wenn diese Infrastruktur als Voraussetzung nicht da ist, dann können eben auch die entsprechenden Anwendungen nicht laufen wie gewünscht. Das finde ich schon bedenklich, dass Deutschland sich so schwer tut, da voranzukommen.
Es ist ja nicht so - wie Sie vorhin gesagt haben, Geld ist nicht alles - dass es hier unbedingt an Geld mangelt. Der Bund hat ja da auch Gelder zur Verfügung gestellt, die von den Kommunen dann abgerufen werden müssen. Aber da sind die Antragsverfahren zum Teil so bürokratisch, dass das Geld eben zum Teil gar nicht abgerufen wird.
Deutschlandfunk Kultur: Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass man sich in Deutschland und in Europa nicht von digitaler Infrastruktur Dritter abhängig oder zu abhängig macht? Erinnert sei an die aktuelle Diskussion um die Beteiligung des staatsnahen chinesischen Kommunikationstechnologiekonzerns Huawei beim Ausbau von 5G.
Bertschek: Das ist eine sehr schwierige Frage. Zum einen kann es ja durchaus sehr effizient sein, Komponenten von chinesischen Anbietern einzukaufen, anstatt die jetzt selbst herzustellen. Auf der anderen Seite kann es Sicherheitsrisiken bergen.
Deutschlandfunk Kultur: Wie sehen Sie es denn? Bürgt es? Sehen Sie mehr Risiken als Chancen?
Bertschek: Also, ich persönlich sehe mehr Chancen als Risiken, aber ich denke, man kann versuchen die Risiken einzugrenzen durch bestimmte Auflagen oder durch bestimmte Tests und durch bestimmte Restriktionen. Man kann natürlich auch selbst Infrastruktur aufbauen. Das wird ja jetzt auch im Kontext einer Cloud, einer europäischen oder deutschen Cloud diskutiert, die entwickelt werden soll, um sich nicht abhängig zu machen von chinesischen oder US-Anbietern. Aber auch hier ist die Frage: Ist es effizient, dies zu tun? Und wenn, dann muss man eben auch schnell vorankommen, die relevanten Akteure wirklich in ein Boot holen und diese Idee dann möglichst schnell umsetzen. Dann kann man seine eigenen Standards setzen für sicheren Datentransfer.
Fortschritte bei Digitalisierung der Verwaltung "unterirdisch"
Deutschlandfunk Kultur: Das zum Stichwort Infrastruktur. Aber die Politik muss natürlich auch bei sich selber anfangen, was Digitalisierung angeht. Denn die digitale Verwaltung, der Onlineservice für mehr oder weniger alle staatsbürgerlichen Aspekte - wie man das von schon Estland kennt - das ist in Deutschland Zukunftsmusik.
Bertschek: Ja. Da haben Sie absolut Recht. Das ist unterirdisch, auch hier die Platzierung: Im EU-Vergleich liegt Deutschland hier auf Platz 24 von 28. Und was besonders bedenklich ist: die Platzierung wurde in den letzten Jahren eher schlechter als besser. Das heißt, andere Länder ziehen vorbei. Es gibt immer noch wenig Dienste, die online angeboten werden. Die Dienste sind also zum Teil sehr lückenhaft, wenig durchgängig und auch wenig nutzerfreundlich.
Natürlich ist es in Deutschland ein Problem oder ein Hemmnis, dass wir ein föderales System haben. Das heißt, die Bundesländer haben ihre eigenen Verwaltungssysteme, die Kommunen, der Bund. Die müssen miteinander verzahnt werden. Das ist sicherlich schwieriger als in einem Land wie Estland. Gleichwohl ist nun auch schon recht viel Zeit verstrichen und man ist bisher nicht vorangekommen. Es wäre aber ganz wichtig, dass der Staat hier, dass die Bundesregierung hier ein Zeichen setzt und beispielhaft vorangeht und sagt: Wir nehmen das selbst ernst mit der Digitalisierung und digitalisieren unsere Verwaltungsdienste und dann ziehen andere eben auch hinterher.
Deutschlandfunk Kultur: Inwieweit ist es denn ein Problem, dass diejenigen, die so etwas befördern können, bremsen können oder beschleunigen können, noch sehr stark im analogen Zeitalter verhaftet sind und vielleicht teilweise überhaupt nicht erkennen können, wie dringlich diese Entwicklungen sind?
Bertschek: Das mag sein, dass das so ist. Also, wie soll ich sagen? Es tut ja nicht unbedingt weh, wenn ein Dienst nicht online verfügbar ist. Es tut nicht so weh wie andere Dinge, die vielleicht weh tun, wenn sie nicht funktionieren. Deshalb lässt es sich da leicht sagen, "ja, wir müssen das machen, aber die Welt geht nicht unter, wenn wir es nicht machen". Ich glaube, diese Einstellung oder die Relevanz, Dienste zu digitalisieren, Verwaltungsdienste zu digitalisieren, hat immer noch nicht diese Priorität, die sie eigentlich braucht, um dann wirklich umgesetzt zu werden.
Deutschlandfunk Kultur: Ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang mit der Digitalisierung ist Weiterbildung. Denn die besten Ingenieure nützen einfach nichts, wenn sie nicht gewappnet sind für die Veränderungen am Arbeitsmarkt, wenn sie nicht über digitale Kenntnisse verfügen. Ist das aus Ihrer Sicht Aufgabe des Staates, diese Weiterbildungen zu organisieren, oder der Betriebe oder der Gewerkschaften, der Unis, des Einzelnen?
Bertschek: Na ja, es ist eine Mischung. In erster Linie würde ich schon die Unternehmen in der Pflicht sehen und auch die Einzelnen, die Individuen, die Beschäftigten oder Nichtbeschäftigten. Denn die wissen am besten, welche Bedürfnisse sie haben. Die Unternehmen können entscheiden, wenn sie ein neues digitales System einführen, ein neues Softwaresystem oder wenn sie bestimmte Prozesse digitalisieren, neue Dienste anbieten, dann können sie auch am ehesten entscheiden, welche Kompetenzen sie benötigen, und können ihre Beschäftigten dann auch entsprechend weiterbilden.
Deutschlandfunk Kultur: Also, dann liegt die Zukunft bei Entwicklungen wie zum Beispiel der, dass der Autozulieferer Continental ein eigenes Weiterbildungsinstitut gründet?
Bertschek: Na ja, er muss nicht unbedingt ein eigenes Institut gründen, aber er kann sich mit anderen Automobilzulieferern zusammenschließen und dafür sorgen, dass beispielsweise Weiterbildungsanbieter - dafür gibt’s ja Institutionen - entsprechende Kurse anbieten oder sich die Weiterbildungstrainer ins Haus holen oder digitale Weiterbildungselemente nutzen.
Verpasst die deutsche Wirtschaft ihre Zukunft?
Deutschlandfunk Kultur: Dass die Politik am einen oder anderen Eck schläft oder geschlafen hat, darüber haben wir schon diskutiert. Aber auch die deutsche Wirtschaft kriegt nicht die allerbesten Zensuren. Sie verpasst ihre Zukunft. "Auslaufmodell Deutschland" war ein Titel, den der Spiegel vor ein paar Monaten mal hatte.
Ist es so, dass das Bewusstsein dafür, dass wir tatsächlich am Anfang oder schon mitten drin in einer neuen industriellen Revolution sind, immer noch nicht überall angekommen ist, auch bei den Unternehmen nicht, die noch immer glauben, dass Digitalisierung für sie keine Priorität haben muss?
Bertschek: Ich denke, das hat sich in den letzten Jahren doch sehr stark geändert. Also, das Bewusstsein dafür, dass Digitalisierung ein wichtiges Thema ist, hat sich geändert. Die Unternehmen sind sich durchaus bewusst, dass es wichtig ist. Es gibt nicht mehr so viele, die sagen, es ist nicht relevant. Das hat auch eine Studie ergeben, die wir für das Bundeswirtschaftsministerium durchgeführt haben. Da ist der Anteil der Unternehmen, die sagen, Digitalisierung spielt für uns keine Rolle oder ist nicht relevant, doch in den letzten Jahren stark zurückgegangen.
Deutschlandfunk Kultur: Aber zurückgegangen ist gleichzeitig auch die Innovatorenquote - also der Anteil an Unternehmen, die innerhalb von drei Jahren mindestens eine Produkt- oder Prozessinnovation durchführen. – Das passt ja dazu nicht.
Bertschek: Es passt zum Teil schon. Also, es ist so: Innovation ist ja ein Begriff, der umfangreicher ist als Digitalisierung, würde ich sagen. Das heißt, nicht jedes Digitalisierungsprojekt ist unbedingt ein Innovationsprojekt. Viele sind es, aber nicht aus jedem Digitalisierungsprojekt entsteht ein neues Produkt oder ein neuer Dienst, sondern zum Teil werden einfach Prozesse effizienter gemacht. Eine Webseite wird neu aufgesetzt. Der Kundenkontakt wird digitalisiert. Die Unternehmen beginnen in sozialen Medien zu kommunizieren, zu werben oder Kundenfeedback einzuholen. Das sind nicht unbedingt die Elemente, die dann auch als Innovation, als realisierte Innovation gemessen werden. Deswegen kann man das nicht unbedingt gleichsetzen.
Es werden durchaus jetzt mehr Digitalisierungsprojekte umgesetzt, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Deutschlandfunk Kultur: Was bedeuten all diese Entwicklungen, die wir in dieser Sendung nur anreißen können, an radikalen Veränderungen für den Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt 4.0 ist ein anderer als alles, was wir bisher gekannt haben. Es werden eine Menge Arbeitsplätze verloren gehen. Soviel steht schon fest. Je nachdem, welche Studie man zitiert, geht die Hälfte der Arbeitsplätze weg oder mehr noch.
Die Frage ist ja: Wie sieht es netto aus? Also, werden unterm Strich mehr neue Jobs entstehen, als alte wegfallen? Wie sehen Sie das?
Bertschek: Die Studien, die es bisher gibt, gehen durchaus in unterschiedliche Richtungen, wie Sie schon gesagt haben. Es gibt diese viel zitierte Studie von Frey/Osborne für die USA, die gezeigt haben, dass fast jeder zweite Arbeitsplatz ein hohes Risiko hat, durch Automatisierung wegzufallen. Der Nachteil dieser Studie war, dass sie ganze Berufe betrachtet hat. Das ist eine sehr extreme Sichtweise.
Es gibt eine andere Studie, die das ZEW durchgeführt hat, die darauf basiert, dass Berufe sich aus unterschiedlichen Tätigkeiten zusammensetzen und dass ein und derselbe Beruf auch in unterschiedlichen Jobs unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Beispielsweise eine Hotelkauffrau kann in einem Hotel nur an der Rezeption tätig sein und interaktive Tätigkeiten durchführen, in einem anderen Hotel beispielsweise auch für den Einkauf und die Rechnungstellung usw. zuständig sein.
Wenn man diesen tätigkeitsbasierten Ansatz zugrunde legt, dann sieht die Welt nicht so negativ aus. Dann zeigt sich, dass nur neun Prozent der Arbeitsplätze in den USA und zwölf Prozent in Deutschland gefährdet sind, automatisiert zu werden.
Aber selbst das ist nur eine Seite. Was bei der Analyse oft nicht berücksichtigt wird, ist, dass es noch andere Wirkungskanäle gibt. Durch Digitalisierung entstehen ja auch neue Produkte und Dienste. Das schafft neue Nachfrage und dann auch neuen Bedarf an Beschäftigung. Wenn man diese Wirkungskanäle alle zusammen betrachtet, dann ist der Nettoeffekt eher positiv.
Es wird nicht "zur Massenarbeitslosigkeit" kommen
Deutschlandfunk Kultur: Das sehen andere anders. Zum Beispiel in den USA Richard Baldwin. Er hat in seinem Buch "Globotics Upheaval" von Entwicklungen gesprochen, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben, indem er sagt, dass das Zusammentreffen der Globalisierung - er spricht von einer zweiten Welle, die da im Moment rollt - mit dem technologischen Fortschritt im Bereich Digitalisierung und Robotik noch viel mehr Bewegung in das Outsourcen von Arbeitsplätzen kommen wird. Und es wird vor allen Dingen Verlierer dieser Entwicklung geben, wo es bisher eigentlich nur die Gewinner gab - also in den Berufen, die durchaus ein hohes Ausbildungsniveau haben, vielleicht studierte Berufe sind. Wir reden hier von Juristen. Wir reden von der Medizin - also weit in die Mittelschicht hinein die Bedrohung von Arbeitsplätzen kommen kann.
Bertschek: Ja natürlich, das sind alles mögliche Wirkungen.
Deutschlandfunk Kultur: Die Sie aber nicht sehen?
Bertschek: Ich sehe die durchaus. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt zur Massenarbeitslosigkeit kommt oder zu so massiven Verschiebungen für bestimmte Berufsgruppen kommt. Das glaube ich nicht, weil es Anpassungsprozesse gibt. Die hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Natürlich kann man nicht immer alles von der Vergangenheit auf die Zukunft übertragen. Wir wissen auch nicht, was in der Zukunft genau passiert. Wir können es nicht vorhersagen.
Aber ich denke, dass solche Wirkungen möglich sind. Auch im Zeitalter der Computerisierung wurden ja zum Beispiel im Finanzmarktbereich die mittelqualifizierten Bankangestellten ersetzt durch den Bankautomaten. Da hatten wir auch so eine sogenannte Polarisierung der Beschäftigung. Das kann natürlich auch weiter vorangetrieben werden. Und mit Digitalisierungsanwendungen wie der Künstlichen Intelligenz kann das dann auch höher qualifizierte Tätigkeiten betreffen.
Aber ich glaube trotzdem, dass wir die Berufe oder die Tätigkeiten, die interaktiv, analytisch, kreativ sind, immer noch zusätzlich brauchen zur Anwendung dieser digitalen Technologien.
Deutschlandfunk Kultur: Nur ist nicht jeder Mensch kreativ und innovativ und intelligent. Das Schicksal der Laternenanzünder - ein Beruf, den es 500 Jahre lang gab und der dann mit der Elektrifizierung der Straßenlaternen wegfiel. Aber da weiter zu qualifizieren, dürfte noch vergleichsweise einfach gewesen sein. Aber es ist ja nicht jeder in der Lage, jede Art von Bildung, Ausbildung, Weiterbildung zu durchlaufen.
Bertschek: Das ist sicherlich richtig, aber es gibt auch Berufe, also Gegenargument zu dem Offshoring, was Sie genannt haben, ist das sogenannte Reshoring, was genauso diskutiert wird in der wissenschaftlichen Literatur. Demnach ist die Hypothese, dass zum Beispiel durch Digitalisierung und durch 3D-Druck auch Aufgaben, Tätigkeiten, die ins Ausland ausgelagert wurden in den letzten Dekaden, wieder zurückgeholt werden, weil man eben durch die Technologie bestimmte Produkte günstiger im Inland herstellen kann als im Ausland. Das sind auch solche Effekte. Das würde ja auch Menschen betreffen, die vielleicht nicht die höchste Qualifikation brauchen, sondern auch mit einer mittleren Qualifikation dann davon profitieren würden. Ich glaube, es gibt einfach zu viele gegenläufige Effekte, als dass man wirklich sagen kann: Der Nettoeffekt ist eindeutig so oder so.
Also, für Deutschland gibt es eine Studie, wo die Vorhersage ist, dass in den nächsten Jahren – sagen wir – bis 2030 ein leicht positiver Effekt für die Beschäftigung möglich ist.
Veränderungen können jeden betreffen
Deutschlandfunk Kultur: Nochmal zurück zu den Laternenanzündern. Die sind seinerzeit dann auf die Straße gegangen, haben protestiert gegen die Abschaffung ihres Berufs sozusagen. Wir wissen, dass technologische Entwicklung immer auch Motor war für Wandel, sogar für Verbesserung von Lebensverhältnissen war. Vor 1770 - das fand ich eine interessante Zahl - verdoppelte sich das Prokopfeinkommen in der Welt alle 6.000 Jahre, seitdem alle fünfzig.
Aber natürlich hat jede technische Innovation immer Verlierer und Gewinner. Sie fürchten nicht, dass mit dieser neuen industriellen Revolution diesmal tatsächlich mehr Verlierer als Gewinner produziert werden und dann entsprechend auch vielleicht soziale Unruhen bevorstehen?
Bertschek: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass man anpassen muss, dann man weiterbilden muss, ausbilden muss, dass man sich drauf einstellen muss, dass die Veränderung jeden betreffen kann. Aber ich glaube, dass es bewältigbar ist. Wenn die entsprechenden Akteure - also Unternehmen, Beschäftigte, Politik, Gewerkschaften - hier an Lösungen gemeinsam arbeiten und Lösungen entwickeln, dann denke ich, dass das machbar ist, so wie es in der Vergangenheit auch war.
Deutschlandfunk Kultur: … und wenn wir unsere sozialen Sicherungssysteme anpassen, denn die sind eigentlich nicht auf solche Entwicklungen eingestellt. Muss man zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, weil einfach nicht jeder Mensch mit jeder Qualifikation noch irgendwo Arbeit finden wird?
Bertschek: Nein. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube zunächst mal nicht, dass bestimmten Qualifikationsgruppen oder Berufsgruppen die Arbeit ausgeht, sondern, wie ich eben schon sagte, ich denke, dass man durch Anpassung, durch Weiterbildung, durch Entstehung neuer Jobs - es werden ja neue Jobs auch entstehen zum Beispiel im Servicebereich - dass im Prinzip jeder und jede auch in der Lage sein wird, so wie bisher auch, durch entsprechende Anpassungen einen neuen Job zu finden.
Es ist wichtig, dass man die Menschen dabei unterstützt, dass man sie weiterbildet, dass man ihnen auch Mobilität zwischen Berufen und zwischen Branchen erleichtert. Es wird auch Verschiebungen zwischen Branchen geben. Die haben wir ja auch in anderen Bereichen, siehe Kohlebergbau. Da haben wir jetzt keinen technologischen Treiber, aber wir haben andere Gründe dafür, dass auch hier Arbeitsplätze abgebaut werden und die Menschen irgendwie eine neue Arbeit finden müssen.
Aber ich glaube nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Lösung ist, weil ich denke, dass es auch nicht finanzierbar ist.
Deutschlandfunk Kultur: Eines dürfen wir jedenfalls festhalten: Ihr Job als Expertin für Digitalökonomie dürfte als sicher gelten. –
Vielen Dank für das Gespräch.
Bertschek: Danke auch.