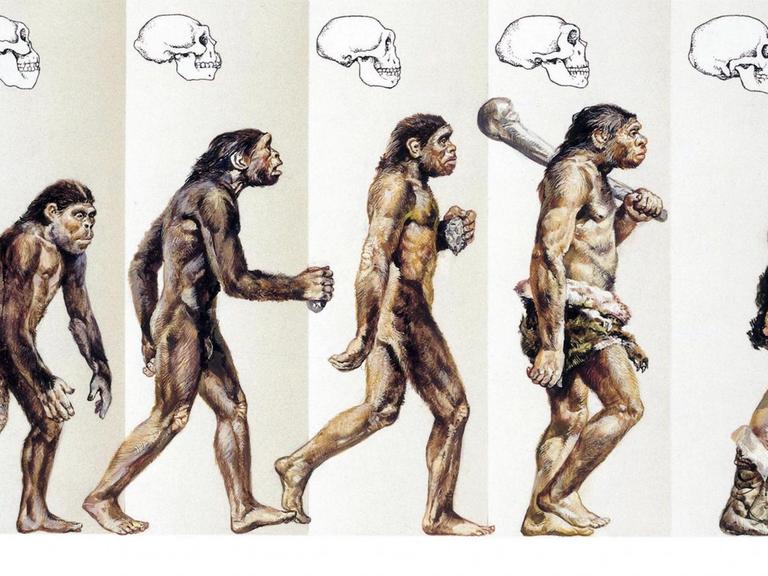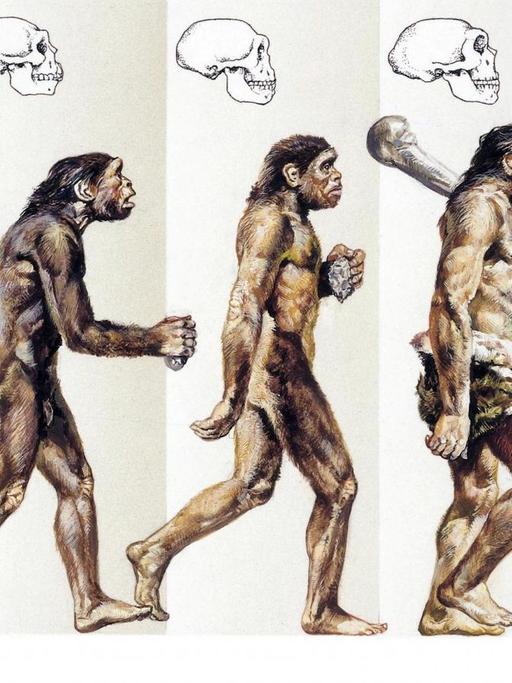Tausche Bühne gegen Surfbrett

Von Laura Naumann · 11.11.2017
Theater kann cool sein, aber eben auch richtig nerven, schreibt Laura Naumann in ihrer Kolumne - und träumt davon, Surfen zu lernen und ihrem bisherigen Leben den Rücken zu kehren.
Ich sitze mit acht anderen Frauen in einem Kleinbus, auf dessen Dach acht Surfbretter geschnallt sind und wir brettern über eine portugiesische Schotterstraße. Unserer Surflehrerin jagt den Bus mit 80 km/h um die Kurven, währenddessen gibt sie uns eine Sicherheitseinweisung für später, im Wasser.
Im Radio läuft Justin Bibers "Despacito". Ich bin hier, weil ich die letzten zehn Jahre gefühlt in dunklen Probebühnen, engen Zuschauerräumen und Open Office Dateien verbracht habe. Während andere junge Leute mit Mojitos am Beach abhingen, hab ich mir noch ein Feierabendbier in einer fensterlosen Kantine gegönnt.
Theater kann schon richtig cool sein, das wissen wir alle, aber es zu machen, kann echt nerven. Alle sind immer so angestrengt. Alle haben ständig vor irgendwas Angst. Meistens vorm Versagen. Es wird immer so getan, als ginge es um Leben und Tod. Aber stimmt das wirklich? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das wirklich stimmt.
Gefährliches Vergnügen
Jetzt also: Rote Felsen. Weißer Sand. Green Waves. White Water. Nose. Tail. Leash. Ich wiederhole die neuen Vokabeln, und verheddere mich in meinem Wetsuit – mein Blick ist in den Wellen hängengeblieben. Surfbretter werden aus dem Wasser in die Luft katapultiert, vereinzelte Arme, Beine und Köpfe scheinen sich in alle Richtungen zu überschlagen. Unzählige Surfklassen in unterschiedlichen Neon-Farben gekleidet, kämpfen entlang der Küstenlinie mit den Wellen. Wie kleine Ameisen-Armeen sehen die aus, krabbeln auf die grünen Hügel zu und sind dann, schwapp, verschwunden, oder springen aus dem Wasser wie Lachse, unfreiwillige Lachse. Dazwischen ein paar Profis - Slalom. Highspeed. Hanging Loose. "Always look to the land, never look down", wenn du nach unten guckst, fällst du - haben wir alle gelernt, und das scheint mir eine schöne Weisheit fürs Leben generell zu sein, die aber leichter gesagt ist als umgesetzt – wie man sieht. Ebenso, sich nicht zu wehren, wenn man unter die Welle gerät, sondern sich zu ergeben, seinen Kopf zu schützen und es dann dem Körper zu überlassen, den Weg zurück an die Oberfläche zu finden - um Energie zu sparen, die einem im Ernstfall das Leben retten kann.
Das Leben retten – jetzt also wirklich, denke ich, als ich mein riesiges Anfängerinnen-Board durch den Sand in Richtung Wasser zerre und versuche, einigermaßen lässig dabei auszusehen, denn so sind Surfer und Surferinnen ja: super lässig. Es ist ziemlich windig. Und die Wellen sind echt hoch. Und was die Lachs-Ameisen da aufführen, sieht auch gar nicht mehr witzig aus. Als die erste Welle mich richtig erwischt, denke ich: Was für eine bescheuerte Idee, Laura. Das ist mega-gefährlich. Und du bist ja auch nicht mehr 16.
Jajablabla, du liebst den Ozean, aber du hast keine Ahnung von Strömung und Wind und Gezeiten, und ja, vielleicht kannst du ganz gut schwimmen, aber wenn diese Leash sich um deinen Hals wickelt unter Wasser, dann nützt dir das auch nichts mehr, herzlichen Glückwunsch, echt.
Hinfahren, wo die Wellen am höchsten sind
Unzählige Wellen später, wieder auf dem Brett liegend, Füße geschlossen, Zehen an der Hinterkante des Tails, wie's die Surflehrerin erklärt hat, denke ich: Scheiß drauf. Ich geh einfach zurück ins Theater. Aber dann brüllt sie. Die Surflehrerin brüllt mich an: Paddle! Now! Paddle! Und Befehle sind gar nicht so mein Ding und angebrüllt werden erst recht nicht. Aber ich mach's dann. Ich paddel. Und dann steh ich auf. Hoch. Hinterer Fuß. Vorderer Fuß. Arme nach vorn. Blick zum Strand. Wie's die Surflehrerin erklärt hat. Und dann steh ich. Auf dem Brett. In der Welle. Und - fahre. Also - Surfe. Ich surfe scheinbar. Das ist also Surfen. Krass. Das ist voll krass, denk ich, das ist wie ein Flowmoment beim Proben, nur mal tausend, oder - . Dann verlier ich das Gleichgewicht und flieg' ins Wasser. Das funktioniert nämlich nicht so gut: Nebenbei Dinge denken. Das hatte die Surflehrerin schon angekündigt. Aber das muss ich jetzt auch nicht mehr.
Mein Bedürfnis, etwas zu denken, was normalerweise meinen Alltag stark dominiert, verschwindet, in den Tagen, in denen ich Surfen lerne, fast komplett. Ich bin einfach da, in diesem wilden, salzigen Wasser, voll anwesend und voller Kraft. Der Ozean lässt mich in sich surfen, wenn ich es geschickt anstelle, oder er spuckt mich aus, und meine Vorstellungen von Kontrolle, von Versagen und Leben und Tod zerschlagen sich darüber wie die Brandung.
Ja, und dann nimmt alles einen ganz klassischen Verlauf: Ich entwickele unglaublich vielen neue Muskeln. Ich lerne turnen und carven und rippen und die Strömung zu lesen. Ich kaufe mir Sunblocker fürs Gesicht in allen Farben. Ich miete mir ein Zimmer in einem Fischerdorf. Ich mach ein paar Stunden am Tag irgendeinen Job. Dann schnall ich mein Brett auf mein Autodach und fahre dahin, wo die Wellen heute am besten sind (dafür hab ich eine App). Ich lass mir die Haare langwachsen. Ich finde Anschluss am Strand. Ich werde total lässig. Für die nächsten zehn Jahre.